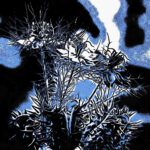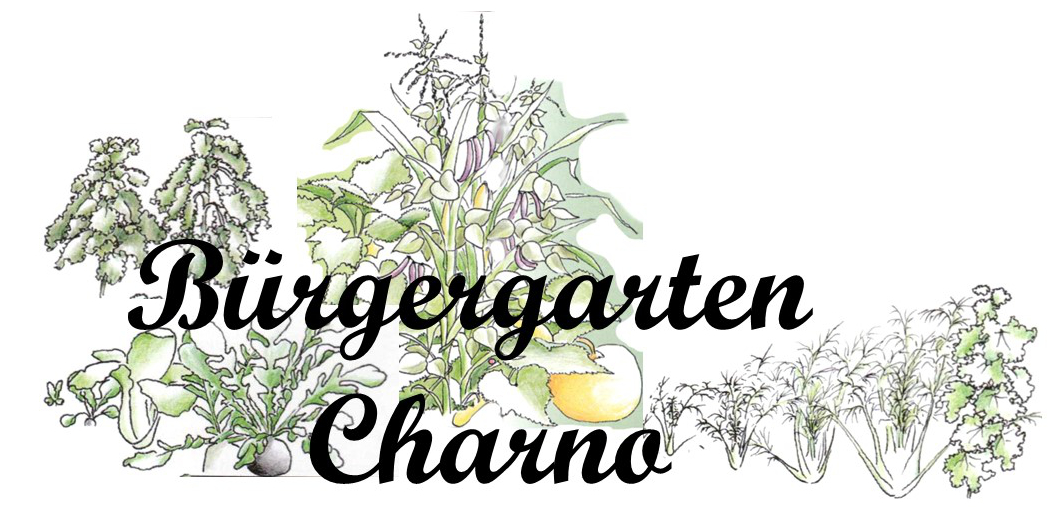Maria Theresa Tietmeyer (Im Buch „Die Symbolik der Pflanzen“ von Marianne Beuchert, 2004)
So stellt sich die Grafikerin Maria Theresa Tietmeyer in dem Buch „Die Symbolik der Pflanzen“ von Marianne Beuchert (2004) ein „Tschaabgsi“-Körbchen vor. „Tschaabgsi“ ist ein Mundartwort der Schweiz, das für „beschämt“ steht. Es entspricht dem alten deutschen Wort „Schabab“, das von „abschaben“ kommt und für „Verachtete“ und „Verspottete“ steht. Auch die Geste den ausgestreckten Zeigefinger über den anderen zu reiben, um Spott, Tadel oder Schadenfreude auszudrücken, hat ihre Bedeutung vom „Abschaben“ und heißt deshalb auch oft „Rübchen schaben“.
Weil „Schabab“ aber sehr dem arabischen „Shabab“ (junge Männer), dem Kurznamen der Terrormiliz „al-Shabaab“ oder auch dem jüdischen „Schabbat“ (Ruhetag) ähnlich klingt, bevorzugen wir das schweizerische Wort „Tschaabgsi“.
| Tschaabgsi-Pflanzen (dt. Name) | Botanischer Name | Blühzeitpunkt | Weitere Bedeutung (nach W.D. Storl) |
| Jungfer im Grünen | Nigella damascena | Juni bis August | Du bist ein Schwächling. |
| Schafgarbe | Achillea millefolium | Mai bis Oktober | Du bist nicht mein Traummann. |
| Kornblume | Centaurea cyanus | Juni bis Oktober | Du kannst nicht treu sein. |
| Wegwarte | Cichorium intybus | Juli bis Oktober | Ich will nicht immer allein sein. |
| Kreuzkraut | Senecio vulgaris | ab Februar bis November | Du bist zu alt für mich. |
| Augentrost | Euphrasia rostkoviana | Juli bis September | Ich will wegen dir nicht weinen. |
| Kornrade | Agrostemma githago | Juni bis August | Ich will nicht immer bitteres Brot essen müssen. |
| Zwiebel | Allium cepa | Mai bis Juni | Du bist mir zu derb. |
| Muskatellersalbei | Salvia sclarea | Juni bis Juli | Ich kann dich nicht riechen. |
Ein Tschaabgsi ist ein Körbchen mit Pflanzen, das dem Verehrer überreicht wurde und damit sehr deutlich machte, dass sein Werben sinnlos ist und er abgewiesen wurde und dass er verschwinden soll („Schieb ab!“). Im Körbchen von Maria Theresa Tietmeyer sind fast alle diese Tschaabgsi-Pflanzen vereint, so dass eine solche Abfuhr-Bekundung sehr extrem gewesen wäre, aber eben auch den sehr großen Aufwand bekundet hätte, um diesen Korb zusammenzustellen. Zumal er wäre nur von Juli bis September, also nur in drei Monaten, so zu pflücken gewesen.
Der Aufwand macht mich stutzig. Zudem schreibt Wolf-Dieter Storl in seinem Buch „Die Unkräuter in meinem Garten“ den jeweiligen Pflanzen eine weitere Bedeutung zu (siehe Tabelle), mit denen eine Begründung für die Zurückweisung verbunden ist.
Ich nehme deshalb an, dass ein Tschaabgsi-Körbchen eher aus einer einzelnen oder wenigen Pflanze bestand und dass das Körbchen aus natürlich wachsenden Körbchen (z. B. Samenkapsel vom Stechapfel, Schwarzkümmel, Kornrade, oder zusammengesteckten Kletten, oder dem Samenstand der Wilden Möhre) bestanden hat. Dann wäre der Aufwand deutlich reduziert, der Zeitraum für ein solches Körbchen fast über das ganze Jahr gestreckt, das Körbchen könnte recht klein sein und leicht und verdeckt zu transportieren sein, damit auch leichter heimlicher zu übergeben sein, und die Botschaft könnte spezifischer werden durch die Wahl der Tschaabgsi-Pflanze.
In jedem Fall sind Tschaabgsi-Körbchen eine alte Tradition, die lange vor dem Trend zu Anfang des 19.Jahrhundert, mit der „Sprache der Blumen“ zu reden, existierte. Die Tschaabgsi-Pflanzen bekommen in den damals veröffentlichten Büchern teilweise andere Bedeutung zugeschrieben, was aber mit der Entfremdung der Bürger in den Städten von der Landwirtschaft verbunden sein dürfte. Die Kornblume wurde zur „preußischen Blume“, weil Kaiser Wilhelm I. sie gerne mochte und zu seiner persönlichen Blume erklärte.
Die Pflanzen sind aus verschiedenen Gründen Tschaabgsi-Pflanzen. In den meisten Fällen sind die dem Bauern ein großes Ärgernis bei der Ernte oder der Verarbeitung der Ernte gewesen. Teilweise sind sie giftig und manche waren als „Gewitterpflanzen“ verschrien. Manche sind auch als Heilkräuter verwendet worden, aber auf dem Acker und auf der Weide waren sie unerwünscht.
Die Schafgarbe war auf den Weiden und Heuwiesen als sehr wüchsige und konkurrenzfähige Pflanze ungern gesehen, weil sie Sensen wegen ihrer Stängel schnell stumpf werden ließ und zudem Bitterstoffe enthält, womit der Wert des Weidefutters und des Heus geschmälert wird.
Kornblumen galten den Bauern als Korndämonen, weil sie sich rasch in Rogggenfeldern ausbreiten, den Ertrag schmälern und bei der Ernte störend sind, da sie wegen ihrer festen Stiele Sensen und Sicheln schneller stumpf werden ließen. Die abgepflückten Blüten der Kornblume wechselt auch öfter ihre Farbe von blau nach weiß, was mit Wankelmut und Unbeständigkeit verbunden wurde. Die Kornblume durfte damals nicht ins Haus geholt werden, da man glaubte, dass sie Brot schimmelig werden ließ.
Die Jungfer im Grünen musste aus dem Getreide ausgesiebt werden, weil die Samen leicht narkotisierend sind.
Kreuzkraut ist selbst heute noch für den Gemüseanbau kritisch, weil die Pflanze sehr wüchsig ist und sehr gut sich durch Samen verbreitet. Sie ist giftig und wenn sie z.B. unter Rucula wächst, fällt sie wegen ähnlicher Blätter kaum auf. Damals war es auf den Weiden und Heuwiesen schädlich, weil Rinder und Pferde auf die leberschädigen Giftstoffe sehr empfindlich reagieren.
Genauso war die Kornrade ein sehr ungern gesehenes Ackerunkraut, weil sie wegen der Kombination von Saponinen und inhibierenden Proteinen giftig ist. Bei mangelhafter Reinigung des Getreides führt der Samen der Kornrade zu einem bläulichen Mehl, was kaum verkäuflich war. Die Kornrade galt auch als Gewitterpflanze, die nicht ins Haus geholt werden durfte, da sie Blitze anziehen sollte. Auch die Wegwarte galt als Gewitterpflanze, die nicht ins Haus geholt werden durfte.
Die Wegwarte wechselt ihre Blütenfarbe von Blau nach rot, wenn man sie nah über einem Ameisenhaufen bewegt, und die Ameisen sie zur Verteidigung mit Säure bespritzen. Das damals unverstandene Phänomen brachte auch ihr, wie der Kornblume, das Attribut der Unbeständigkeit.
Der Augentrost ist eine schmarotzende Pflanze, der mit seinen Saugwurzeln benachbarten Gräsern Mineralien und Nährstoffe direkt aus deren Wurzeln entzieht und so deren Wachstum hemmen kann. Aus dieser Eigenschaft resultieren auch die Namen Wiesenwolf oder Milchdieb, da durch den schlechteren Wuchs der Gräser der Ertrag des Weideviehs und deren Milchleistung gemindert werden konnte.
Muskatellersalbei wurde in der Schweiz auch in Tschaabgsi-Körbchen gesteckt, weil er ähnlich wie alter Schweiß oder Hundekot riecht und insbesondere in geschlossenen Räumen von vielen Menschen als unangenehm wahrgenommen wird.
Quellen:
- Wolf-Dieter Storl: Die Unkräuter in meinem Garten (2018)
- Marianne Beuchert: Die Symbolik der Pflanzen (2004)
- Heinrich Marzell: Volksbotanik (1935)
- Maria Heilmeyer: Die Sprache der Blumen (2012)